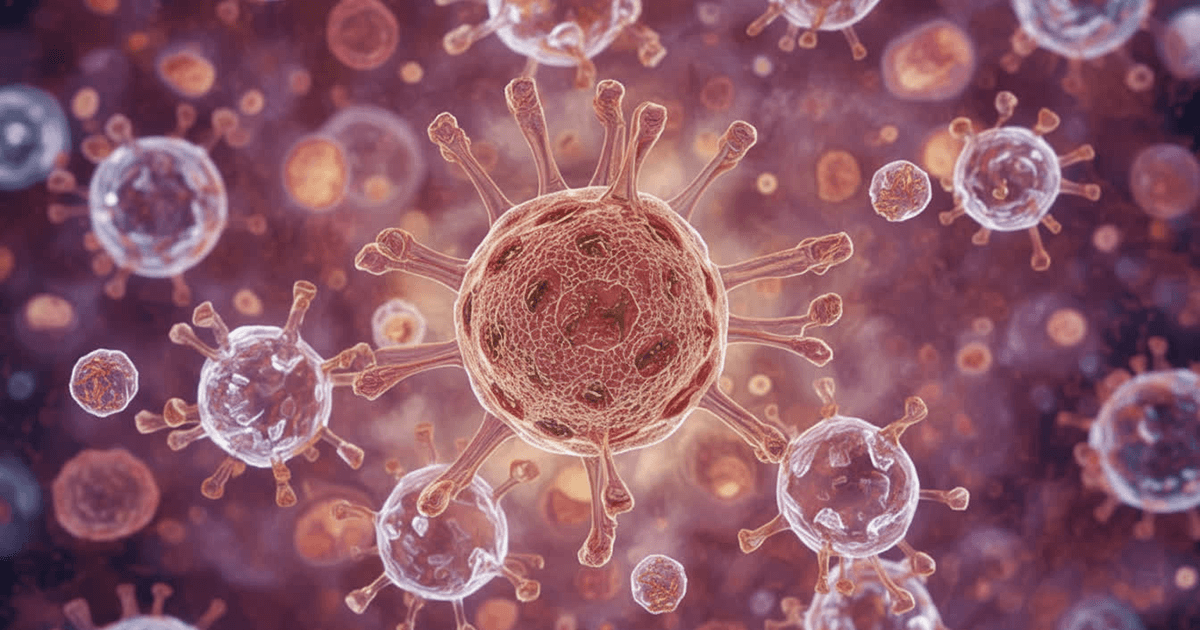Du willst alt werden – aber bitte mit Kraft, klarer Birne und Spaß an Bewegung? Dann stößt du früher oder später auf ein Schlagwort, das in der Longevity-Welt gerade viel Aufmerksamkeit bekommt: Senolytika. Hinter dem schwierigen Begriff steckt eine simple Idee: den „Zellmüll“ des Alters aufräumen. In diesem Artikel nehme ich Dich ohne Fachchinesisch mit durch das Thema. Du erfährst, was Senolytika sind, warum sie so viele Forschende elektrisieren, was beim Menschen wirklich bekannt ist – und wer an welchen Wirkstoffen arbeitet. Außerdem bekommst du eine Einordnung durch bekannte Stimmen aus der Longevity-Szene und klare Hinweise, was heute sinnvoll ist und was noch Zukunftsmusik bleibt.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient der Information und ersetzt keinen ärztlichen Rat. Viele Senolytika sind verschreibungspflichtige Medikamente aus der Onkologie oder experimentelle Wirkstoffe. Bitte keine Selbstexperimente – sprich mit einem Arzt, wenn dich das Thema konkret interessiert.
Was sind seneszente Zellen – und was sollen Senolytika dort tun?
- Stell dir Zellen vor, die in eine Art „Dämmerzustand“ wechseln: Sie teilen sich nicht mehr, sind aber nicht tot. Diese Zellen nennt man seneszent. Sie entstehen zum Beispiel durch Stress, kleine DNA-Schäden, Entzündungen oder schlicht durchs Älterwerden.
- Das Problem: Seneszente Zellen senden einen Mix aus Alarmstoffen (entzündliche Botenstoffe) in ihr Umfeld. Das hält Wunden länger offen, macht Gewebe steifer, belastet Gefäße, Gelenke und Stoffwechsel – und fördert mit der Zeit Krankheiten wie Arthrose, Herz-Kreislauf-Probleme oder Diabetes. Populär heißen sie „Zombie-Zellen“ – das ist vereinfacht, trifft aber den Kern: Sie sind da, funktionieren nicht mehr richtig und stören andere.
- Senolytika sind Wirkstoffe, die gezielt solche seneszenten Zellen zum Absterben bringen. Bildlich: selektiver Frühjahrsputz für altes Gewebe. Wichtig ist „selektiv“ – gesunde Zellen sollen verschont bleiben.
Senolytika vs. Senomorphika: Verwechsel sie nicht!
Senolytika: räumen seneszente Zellen aktiv aus dem Weg.
Senomorphika (auch „Senostatika“): beruhigen den schädlichen Zellsignal-Cocktail oder verhindern, dass zu viele neue Problemzellen entstehen – sie beseitigen sie aber nicht. Zu den Senomorphika zählt man oft Substanzen wie Rapamycin, Metformin oder Resveratrol. Nützlich, aber ein anderes Werkzeug.
Warum ist das so spannend?
- In Tierstudien hat man seneszente Zellen mit Senolytika entfernt. Ergebnis: bessere Muskelkraft, elastischere Gefäße, fittere Herzen, stabilere Knochen, weniger Gebrechlichkeit – und in einigen Fällen sogar ein längeres Leben.
- Beim Menschen gibt es erste, kleine Studien mit Senolytika. Die Signale sind interessant (bessere Gehstrecken bei Lungenfibrose, günstigere Entzündungsmarker), aber die Datengrundlage ist noch dünn. Große, placebokontrollierte Studien laufen oder sind geplant. Das Feld ist real, aber wir stehen am Anfang.
Wie „erkennt“ ein Senolytikum die Problemzellen?
Seneszente Zellen aktivieren Überlebensschalter, die sie zäh machen. Dazu gehören Schutzproteine, die den programmierten Zelltod blockieren.
Senolytika greifen genau diese Schutzschalter an. Ohne Rettungsleine gehen die Problemzellen kontrolliert zugrunde – und gesundes Gewebe bekommt wieder Luft.
Was zeigt die Forschung bisher?
- Tierwelt: Entfernt man seneszente Zellen, verbessert sich die Gesundheitsspanne oft deutlich. Tiere werden agiler, metabolisch stabiler und erholen sich besser von Stress.
- Menschen: Erste Studien mit Senolytika-Kombinationen wie Dasatinib + Quercetin oder mit Fisetin zeigen Verbesserungen bei Gehstrecke, Entzündungsmarkern oder Gewebemarkern in Biopsien. Aber: kleine Fallzahlen, kurze Dauer, oft ohne Placebo-Kontrolle. Gleichzeitig gab es auch Rückschläge – nicht alles, was in Mäusen wirkt, hilft in komplexen menschlichen Erkrankungen gleich gut.
Senolytika-Kandidaten im Überblick – verständlich erklärt, mit Forschungsteams und Stimmen aus der Szene
Hinweis: Das ist eine Auswahl der aktuell prominentesten Ansätze. Die Forschung ist dynamisch; Programme werden angepasst, pausiert oder neu gestartet.
1) Dasatinib + Quercetin (oft abgekürzt D+Q)
- Was ist das? Dasatinib ist ein Krebsmedikament, Quercetin ein Pflanzenstoff aus Zwiebeln und Äpfeln. Zusammen wirken sie gegen verschiedene Typen seneszenter Zellen. Dasatinib schwächt Überlebenssignale, Quercetin stört Stresswege in den Problemzellen.
- Was wissen wir? In Mäusen sehr wirksam gegen alters- und krankheitsbedingte Schäden. Beim Menschen zeigen kleine Studien bei Lungenfibrose und Nierenerkrankungen Verbesserungen bei Funktionstests und Biomarkern. Größere Studien sind nötig.
- Wer forscht daran? Pionierarbeit kommt vom Team um James Kirkland und Tamara Tchkonia an der Mayo Clinic; auch das Buck Institute (u. a. Judith Campisi) war früh dabei. Klinische Pilotstudien wurden teils von Mayo- und Partnerkliniken durchgeführt.
- Stimmen aus der Longevity-Welt: Judith Campisi gilt als Mitbegründerin des Feldes und betont Potenzial und Risiken. David Sinclair sieht Senolytika als vielversprechend, warnt aber vor Selbstmedikation, besonders bei Dasatinib. Peter Attia und Matt Kaeberlein sind eher vorsichtig: interessante Biologie, aber bisher zu wenig robuste Human-Daten für eine breite Empfehlung.
2) Fisetin
- Was ist das? Ein Pflanzenfarbstoff, besonders in Erdbeeren. Als Nahrung bekommst du Mikro- bis Milligramm-Mengen; in Studien werden weit höhere Dosen geprüft.
- Was wissen wir? In Mäusen wirkt Fisetin wie ein mildes, breites Senolytikum und verbessert entzündliche Werte und Fitness. Erste Humanstudien zu Gebrechlichkeit und Stoffwechsel laufen; frühe Marker-Daten sind ermutigend, harte Endpunkte stehen aus.
- Wer forscht daran? Treiber sind die Gruppen von Paul Robbins und Laura Niedernhofer (University of Minnesota). Auch die Mayo Clinic testet Fisetin in klinischen Settings.
- Stimmen: David Sinclair nennt Fisetin häufig, betont aber die Lücke zwischen Maus und Mensch. Matt Kaeberlein verweist auf die noch unklare Wirksamkeit beim Menschen. Viele Forschende halten Fisetin für eines der „sanfteren“ Senolytika – mit dem Vorteil, dass es als Nahrungsergänzung zugänglich ist, aber Qualitäts- und Dosierungsfragen offen sind.
3) Navitoclax (ABT-263) und andere BCL-2/BCL-xL-Hemmer
- Was ist das? Krebswirkstoffe, die wichtige Schutzproteine in Zellen hemmen. Seneszente Zellen sind von diesen Proteinen besonders abhängig – deshalb reagieren sie empfindlich. BCL-2 und BCL-xL sind solche Proteine, die den programmierten Zelltod in Zellen verhindert. Es wirkt als Überlebensfaktor, indem es die Freisetzung von Zelltod-auslösenden Substanzen aus den Mitochondrien blockiert – im Falle von seneszenten „Zombie“-Zellen natürlich genau das Falsche….
- Was wissen wir? In Tiermodellen sehr stark senolytisch wirksam. Problem: Nebenwirkungen. Navitoclax kann Blutplättchen stark senken (Blutungsrisiko) – das dämpft den Enthusiasmus für den breiten Einsatz.
- Wer forscht daran? Zahlreiche akademische Gruppen (Mayo Clinic, Buck Institute) in präklinischen Modellen; klinisch wurde Navitoclax vor allem in der Onkologie entwickelt (AbbVie). Unity Biotechnology entwickelte augenspezifische BCL-xL-Hemmer (z. B. UBX1325) für Netzhauterkrankungen; die Signale waren gemischt, Programme wurden teils angepasst.
- Stimmen: Allgemein großes Interesse an der Zielstruktur, aber Einigkeit, dass Sicherheit die Hürde ist. Peter Attia und Matt Kaeberlein verweisen auf das ungünstige Nebenwirkungsprofil klassischer Vertreter – ein Grund, warum Senolytika hier noch nicht „ready for prime time“ sind.
4) FOXO4-DRI (senolytisches Peptid)
- Was ist das? Ein kleines Proteinfragment (-> „Peptid“), das eine interne „Schutzhandschlag“-Interaktion in seneszenten Zellen stört. Dadurch verlieren die Zellen ihre Überlebensversicherung.
- Was wissen wir? In Mäusen gab es beeindruckende Bilder: fittere Tiere, verbesserte Organfunktionen. Aber: Humanstudien fehlen. Stabilität, Verteilung und Sicherheit sind offene Punkte.
- Wer forscht daran? Entwickelt im Umfeld von Peter de Keizer (Erasmus MC), der daraus das Unternehmen Cleara Biotech mitgegründet hat.
- Stimmen: Große Neugier, aber ebenso große Vorsicht. Ohne Human-Daten bleibt FOXO4-DRI ein spannendes Konzept, mehr nicht.
5) Piperlongumin
- Was ist das? Ein Naturstoff aus dem Langen Pfeffer. Er erhöht oxidativen Stress in seneszenten Zellen, die darauf besonders empfindlich reagieren.
- Was wissen wir? Zell- und Tierdaten sehen gut aus. Beim Menschen gibt es noch keine belastbaren Wirksamkeitsstudien als Senolytikum.
- Wer forscht daran? Mehrere akademische Gruppen; frühe Arbeiten kamen aus der Krebsforschung und wurden von Seneszenz-Teams (u. a. Mayo-Umfeld) aufgegriffen.
- Stimmen: Interessant, aber noch ganz am Anfang. „Schönes Laborergebnis“ trifft es bislang.
6) HSP90-Inhibitoren (z. B. 17-DMAG, Ganetespib)
- Was ist das? HSP90 ist eine Art „Molekül-Chaperon“, das viele Proteine stabil hält (der Ausdruck „Chaperon“ bezeichnet in der Biologie ein Protein, das anderen Proteinen dabei hilft, sich korrekt zu falten und ihre dreidimensionale, funktionsfähige Struktur zu erreichen). Nimmt man HSP90 die Arbeit, kollabieren Schutznetzwerke in seneszenten Zellen.
- Was wissen wir? Präklinisch überzeugend, klinisch als Senolytika noch nicht etabliert.
- Wer forscht daran? Präklinisch u. a. Teams an der Mayo Clinic und am Buck Institute.
- Stimmen: Biologisch plausibel, als Medikamentenklasse aber komplex – auch hier gilt: Sicherheit zuerst.
7) Procyanidin C1 (Traubenkern-Extrakt-Fraktion)
- Was ist das? Ein definierter Bestandteil aus Traubenkernextrakt. In höherer, gereinigter Form kann er seneszente Zellen empfindlich machen.
- Was wissen wir? In Mäusen zeigten sich verbesserte Fitness und weniger Entzündung. Nahrungsergänzungen aus dem Handel enthalten meist nicht die exakt geprüfte Fraktion oder Dosis – hier sollte man nicht 1:1 schließen.
- Wer forscht daran? Akademische Konsortien in Europa und Asien; die Substanz wurde in Screening-Programmen identifiziert und präklinisch charakterisiert.
- Stimmen: Spannender Brückenschlag zwischen Naturstoff und Senolytika. Aber: Nahrungsergänzung ist nicht gleich Studienpräparat.
8) Herzglykoside (z. B. Digoxin, Ouabain)
- Was ist das? Alte Herzmedikamente können in bestimmten Dosisfenstern seneszente Zellen stärker treffen als gesunde.
- Was wissen wir? Zell- und Tierdaten zeigen senolytische Effekte; die therapeutische Breite ist aber eng – Überdosierung kann gefährlich sein.
- Wer forscht daran? Teams um Jesús Gil (MRC London Institute of Medical Sciences/Imperial College) und weitere Gruppen untersuchen den Ansatz.
- Stimmen: Elegant als Konzept – in der Praxis heikel. Niemand rät zu Off-Label-Experimenten.
9) Immun-Senolytika (CAR-T und Co.)
- Was ist das? Statt Pillen werden Immunzellen so umprogrammiert, dass sie seneszente Zellen erkennen und entfernen – eine Art „Präzisionspolizei“.
- Was wissen wir? In Mäusen funktionierte z. B. CAR-T gegen ein Oberflächenmerkmal seneszenter Zellen (uPAR). Sehr zielgerichtet, potenziell lang anhaltend.
- Wer forscht daran? Akademische Konsortien in den USA und Europa; führend sind Gruppen aus der CAR-T-Forschung, oft in Zusammenarbeit mit Alternforschern.
- Stimmen: Zukunftsmusik mit großem Potenzial – aber komplex, teuer und bislang rein präklinisch im Longevity-Kontext.
10) Seneszenz-Impfstoffe
- Was ist das? Impfkonzepte, die das Immunsystem gegen typische Merkmale seneszenter Zellen scharf machen (z. B. GPNMB). Ziel: der Körper räumt selbst auf.
- Was wissen wir? In Mäusen verlängerten solche Impfungen teils die Gesundheitsspanne. Menschendaten fehlen.
- Wer forscht daran? Japanische Universitätsgruppen und internationale Partner haben erste Proof-of-Concept-Daten veröffentlicht.
- Stimmen: Sehr spannend, weil minimal-invasiv denkbar. Aber noch „early days“.
11) Galacto-Targeting und Prodrugs
- Was ist das? Seneszente Zellen zeigen oft hohe Aktivität eines Enzyms (β-Galactosidase). Man koppelt Wirkstoffe so, dass sie erst in diesen Zellen „scharf“ werden – wie ein Sicherheitsverschluss.
- Was wissen wir? In Tiermodellen lässt sich so die Selektivität von Senolytika erhöhen und Nebenwirkungen senken.
- Wer forscht daran? Mehrere Universitäten und Biotech-Firmen weltweit; das Prinzip wird mit verschiedenen Wirkstoffklassen getestet.
- Stimmen: Technisch clever, klinisch noch unbewiesen.
12) Oisín Biotechnologies: „Genetisches Senolytikum“
- Was ist das? Eine genbasierte Strategie: Über eine Art Nano-Shuttle wird der Befehl zum Zelltod gezielt in Zellen eingeschleust, die typische Seneszenz-Schalter (z. B. p16) aktiviert haben.
- Was wissen wir? Gute Tierdaten, an großen Tieren und in Haustierstudien getestet; Humanstudien stehen aus.
- Wer forscht daran? Oisín Biotechnologies (USA) mit akademischen Partnern.
- Stimmen: High-Tech-Ansatz mit Charme – die große Frage ist die sichere, breite Anwendbarkeit im Menschen.
13) Curcumin-Derivate, EGCG, Apigenin und „sanfte“ Naturstoffe
- Was ist das? Pflanzliche Substanzen (z. B. von Kurkuma extrahiert) mit entzündungsdämpfenden Eigenschaften. Viele davon wirken eher senomorph – sie beruhigen den schädlichen Cocktail der Problemzellen, statt sie zu entfernen.
- Was wissen wir? Gute Labor- und Tierdaten; klinisch als Senolytika aber unklar. Bioverfügbarkeit und Qualitätsunterschiede spielen eine große Rolle.
- Wer forscht daran? Weltweit zahlreiche akademische Gruppen; oft als Teil größerer Longevity-Programme.
- Stimmen: Kaum Risiko bei üblichen Ernährungsformen, als gezielte Senolytika aber nicht belegt.
Realitätsschcheck: Wo stehen Senolytika 2025 wirklich?
- Starke Biologie, starke Tierdaten. Senolytika sind mehr als Hype.
- Beim Menschen sind wir in der Phase „kleine, meist positive Pilotstudien – aber noch keine breite, klare Evidenz“. Einige klinische Programme (z. B. bei Arthrose) haben enttäuscht, andere liefern gemischte oder vorsichtig positive Signale.
- Sicherheit entscheidet: Viele Senolytika kommen aus der Krebsmedizin und haben Nebenwirkungen. Der Trend geht deshalb zu intermittierenden Schemata (kurze „Aufräum-Blitze“ statt Dauertherapie), zu lokal verabreichten Varianten (z. B. Auge, Gelenk) und zu intelligenteren Targeting-Strategien.
- Ganz wichtig: Was hier beschrieben wird, sind klinische Studien – also streng überwachte, ärztlich betreute Prüfungen. Senolytika sind keine DIY-Strategie. Bitte auf keinen Fall eigenmächtig Medikamente oder hochdosierte Stoffe beschaffen und „privat“ ausprobieren. Wenn dich ein Ansatz interessiert, informiere dich über Studienzentren oder sprich mit deinem Arzt.
Was sagen bekannte Persönlichkeiten zur Senolytika-Forschung?
- Judith Campisi (Buck Institute): Pionierin des Feldes. Sie betont seit Jahren, dass seneszente Zellen auch nützlich sein können (z. B. bei Wundheilung) – die Dosis macht das Gift. Senolytika: ja, aber gezielt und nicht „mit dem Vorschlaghammer“.
- James Kirkland (Mayo Clinic): Treiber hinter vielen Studien zu D+Q. Sieht Senolytika als realistische Option, wenn Selektivität und Sicherheit stimmen. Befürwortet intermittierende Anwendung, sobald Evidenz da ist.
- David Sinclair (Harvard): Optimistisch in Sachen Senolytika, sieht sie als Baustein im Longevity-Werkzeugkasten – mit der klaren Botschaft „Don’t try this at home“, solange große Humanstudien fehlen.
- Nir Barzilai (Einstein College): Bekannt für Metformin-Studien (TAME). Er hält Senolytika für vielversprechend, aber fordert robuste klinische Beweise, bevor man breit empfiehlt.
- Peter Attia und Matt Kaeberlein: Eher konservativ. Sie verweisen auf die Diskrepanz zwischen Maus und Mensch und darauf, dass Lebensstilhebel heute mehr bringen als experimentelle Senolytika.
Was kannst du heute tun – ohne Senolytika-Rezept und Laborzugang?
Auch wenn die meisten Senolytika selbst noch in der Erprobung sind, kannst du deine „Seneszenz-Last“ beeinflussen:
- Krafttraining + Ausdauer: Beides reduziert stille Entzündungen, erhält Muskelmasse und verbessert die Zellreparatur. 2–3 Krafteinheiten pro Woche plus 150–300 Minuten moderates Cardio sind eine solide Basis.
- Schlaf priorisieren: 7–9 Stunden. Im Schlaf laufen Reparaturprogramme, die Zellstress senken.
- Entzündungsarme Ernährung: Viel Gemüse, Beeren, Hülsenfrüchte, Fisch; wenig ultraverarbeitete Lebensmittel. Polyphenole (z. B. aus Beeren, Olivenöl, grünem Tee) wirken eher senomorph – sie beruhigen das Umfeld.
- Gewicht im Check halten: Viszerales Fett befeuert Entzündungen – weniger davon, weniger Nährboden für Problemzellen.
- Mikrostressoren klug dosieren: Kälte, Hitze (Sauna), Intervallfasten und HIIT – richtig eingesetzt – verbessern zelluläre Stressresilienz. Nicht übertreiben, gerade wenn du Vorerkrankungen hast.
- Ernährungszusätze: Einige wenige Senolytika sind als Supplements frei zugänglich:
Fisetin: In Mäusen senolytisch; beim Menschen bislang nur frühe Daten. Qualität und Reinheit variieren stark.
Quercetin: In Studien meist in Kombination mit Dasatinib geprüft; solo eher „senomorph“.
Wenn Du diese Supplements selbst probieren möchtest, hier einige Affiliate Links für Kombi-Präperate in Kapselform:
[Hersteller Cestfilo] – Liposomal Fisetin 1000mg with Quercetin 200 mg 60 Softgels*
FAQ – die häufigsten Fragen zu Senolytika
- Sind Senolytika schon zugelassen?
Als Anti-Aging-Therapie: nein. Einzelne Wirkstoffe sind für andere Indikationen zugelassen (z. B. Krebs), werden aber in Studien „off label“ als Senolytika getestet. - Gibt es Nahrungsergänzungen als Senolytika?
Fisetin, Quercetin und Traubenkernextrakte sind frei erhältlich. Ob handelsübliche Produkte dieselbe Wirkung haben wie die in Studien verwendeten, ist offen. Reinheit, Dosis und Bioverfügbarkeit variieren stark. Bitte keine Hochdosisexperimente. - Wie wahrscheinlich ist es, dass Senolytika den Menschen helfen?
Die Biologie ist schlüssig, Tierdaten sind sehr gut. Beim Menschen ist der Beweis an harten Endpunkten (Krankheit, Behinderung, Lebensdauer) noch ausstehend. Realistisch: gezielte Anwendungen bei bestimmten Krankheiten könnten zuerst kommen; die „Pille fürs lange Leben“ ist nicht in Sicht. - Gibt es Risiken?
Ja. Von harmlos (Magen-Darm-Beschwerden bei Flavonoiden) bis ernsthaft (Blutbildveränderungen bei Krebsmedikamenten). Deshalb gehören potente Senolytika in Studien und in ärztliche Hand. - Werden Senolytika das Altern „heilen“?
Nein. Altern ist multifaktoriell. Senolytika adressieren eine wichtige Schraube – die Anhäufung seneszenter Zellen. Für echte Longevity braucht es mehrere Bausteine: Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stoffwechselkontrolle, Stressmanagement – plus evidenzbasierte Interventionen, sobald sie reif sind.
Fazit
Senolytika versprechen, eine ganz bestimmte Alterslast zu reduzieren: die Ansammlung lädierter, aber überlebender Zellen, die den Körper „anfeuern“, krank zu werden. In Mäusen klappt das Aufräumen und macht Tiere gesünder und manchmal länger lebend. Beim Menschen ist das Kapitel noch in Arbeit. Mehrere Senolytika – von Dasatinib + Quercetin über Fisetin bis zu neuartigen Immun-Therapien – stehen in der Startaufstellung.
Die großen Fragen heißen Selektivität, Sicherheit und echte, klinisch relevante Effekte. Bis wir diese Antworten haben, fährst du am besten zweigleisig: den Alltag „seneszenz-klug“ gestalten – und die Forschung an Senolytika aufmerksam verfolgen, ohne der Zeit vorauszueilen.
Meine Einordnung für Dich:
- Senolytika sind eines der spannendsten Felder der Alternsforschung. Sie sind kein Mythos, aber auch noch keine Routine.
- Für dich heute zählt: die Basics. Wer Kraft, Herz-Kreislauf-Fitness, Schlaf und Ernährung im Griff hat, schafft die Grundlage, damit spätere, sichere Senolytika (falls sie kommen) überhaupt ihren Mehrwert ausspielen können.
- Nochmals klar und deutlich: Senolytika gehören in klinische Studien und in ärztliche Betreuung – Punkt. Bitte keine „private Initiative“ mit Rezeptmedikamenten oder experimentellen Substanzen. Wenn du dich beteiligen möchtest, informiere dich über seriöse Studienregister (z. B. ClinicalTrials.gov) und sprich mit deinem Arzt über Eignung und Risiken.
Weiterführende Informationen und Studien
- Nature (2016): Clearance of p16Ink4a-positive cells delays ageing-associated disorders – Transgene Mausstudie zeigt, dass das Entfernen seneszenter Zellen Alterskrankheiten verzögert und die Gesundheitsspanne verlängert.
- Aging Cell (2015): The Achilles’ heel of senescent cells – from transcriptome to senolytic drugs – Erstbeschreibung mehrerer Senolytika (u. a. Dasatinib + Quercetin) und ihrer selektiven Wirkung gegen seneszente Zellen.
- Cell (2017): Targeted apoptosis of senescent cells by FOXO4-DRI – Peptid FOXO4‑DRI eliminiert seneszente Zellen in Mausmodellen und verbessert Gewebefunktionen.
- Nature (2020): Senolytic CAR T cells reverse senescence‑associated pathologies – CAR‑T‑Zellen, die uPAR erkennen, entfernen seneszente Zellen und verbessern altersassoziierte Beschwerden im Tiermodell.
- ClinicalTrials.gov: Übersicht laufender und abgeschlossener Senolytika‑Studien – Offizielles Studienregister mit Filter für „Senolytic“; zeigt Status, Design und Anlaufstellen.
- ClinicalTrials.gov: Studien zu Dasatinib + Quercetin – Klinische Prüfungen der bekannten Senolytika‑Kombi D+Q in verschiedenen Indikationen.
- ClinicalTrials.gov: Studien zu Fisetin – Laufende Humanstudien zu Fisetin mit Endpunkten wie Frailty, Entzündung und Stoffwechsel.
- ClinicalTrials.gov: Studien zu UBX1325 (BCL‑xL‑Inhibitor) – Prüfprogramme zur lokalen Senolyse im Auge (z. B. diabetisches Makulaödem, AMD).
- ClinicalTrials.gov: Studien zu UBX0101 (MDM2/p53‑Modulator) – Informationen zu Arthrose‑Studien und Ergebnissen dieser senolytischen Strategie.
- Cell Metabolism (2020): Review – Cellular senescence in aging and disease – Übersichtsarbeit zu Mechanismen der Zellseneszenz und therapeutischen Ansätzen inkl. Senolytika.
* Hinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.